 Deutsches
Schiffahrtsmuseum
Deutsches
Schiffahrtsmuseum
Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.
Presse-Info-Service
Info Nr. 05/02 vom 13.03.2002
Ein Gedenkstein in Vík auf Island
Deutsche Hochseefischerei unter Island forderte viele Opfer – Gedenkstein als Zeichen der Erinnerung, Dankbarkeit und Völkerverständigung zwischen Deutschen und Isländern
 Die deutsche Hochseefischerei ist mit Island untrennbar verbunden. Sie
wurde über achtzig Jahre unter Island betrieben und forderte viele
Opfer: In der Zeit zwischen 1898 und 1952 gingen in der Islandfischerei
83 deutsche Fischdampfer verloren und über 1200 Seeleute haben vor
der Küste Islands ihr Leben verloren. Die einen erlitten tödliche
Unfälle auf ihren Schiffen, andere gingen bei schweren Stürmen
über Bord, kamen bei Strandungen und Schiffsuntergängen ums Leben
oder sind mit ihren Schiffen verschollen.
Die deutsche Hochseefischerei ist mit Island untrennbar verbunden. Sie
wurde über achtzig Jahre unter Island betrieben und forderte viele
Opfer: In der Zeit zwischen 1898 und 1952 gingen in der Islandfischerei
83 deutsche Fischdampfer verloren und über 1200 Seeleute haben vor
der Küste Islands ihr Leben verloren. Die einen erlitten tödliche
Unfälle auf ihren Schiffen, andere gingen bei schweren Stürmen
über Bord, kamen bei Strandungen und Schiffsuntergängen ums Leben
oder sind mit ihren Schiffen verschollen.
Die Islandfischerei wurde unter schwierigsten Bedingungen betrieben. Besonders im Winter erschwerte stürmisches Wetter diese Arbeit. Offene Decks boten keinen Schutz gegen überkommende Brecher, die Befeuerung der Küsten war in den Anfängen der Fischerei nur mangelhaft oder fehlte gänzlich. Landmarken, von Kapitänen als Orientierungspunkte verzeichnet, verschwanden häufig nach kurzer Zeit wieder. Astronomische Navigation war kaum möglich und Magnetfelder sorgten für eine starke Kompassabweichung. So gingen viele Schiffe in orkanartigen Stürmen verloren oder strandeten und mussten aufgegeben werden.
Aus der langen Reihe tragischer Einzelschicksale seien an dieser Stelle nur einige genannt. Als erster Totalverlust wurde 1898 die Strandung des Fischdampfers „Präsident Herwig“ an der Südküste Islands registriert. Am 25. Januar 1925 wurde der Fischdampfer „Bayern“ während eines Orkans vor einer hohen Felswand an den Strand getrieben. Eine Rettung von See oder von Land her war unmöglich – alle 13 Besatzungsmitglieder ertranken. Dem gleichen Orkan fiel die „William Jürgens“ vor den Vestmannaeyjar zum Opfer. Der Erste Maschinist ertrank, zwölf Seeleute wurden mit schweren Verletzungen geborgen. Mitte Februar 1933 sind die Fischdampfer „Meteor“ und „Westbank“ mit insgesamt 26 Seeleuten während eines gewaltigen Unwetters im Westen und Südwesten Islands verschollen. Als letzter deutscher Fischdampfer ging 1952 die „N. Ebeling“ während eines Orkans mit 20 Mann Besatzung unter Island verloren.
Bei Strandungen an der Südküste Islands gelang es den Seeleuten häufig, das Land zu erreichen, damit waren sie aber nicht gerettet. Die Strände aus Lavageröll erstrecken sich über eine Länge von etwa 200 km, und die isländischen Gehöfte lagen bis zu 20 km von der Küste entfernt. Gletscherströme stellten ein zusätzliches Hindernis dar, und nicht zuletzt waren steile Felsküsten ohne Hilfe von Land unüberwindbar. So irrte die Besatzung des Fischdampfers „Friedrich Albert“ aus Bremerhaven im Januar 1903 elf Tage an der Küste umher, bis sie schließlich bei eisiger Kälte und Sturm mehr kriechend als gehend das rettende kleine Gehöft Ormstadur erreichte. Die isländischen Küstenbewohner bemühten sich aufopfernd um die Schiffbrüchigen, pflegten und versorgten sie mit Nahrung und Kleidung, ehe sie die Geretteten auf ihren Pferden in tagelangem Ritt nach Reykjavík bringen konnten. Die Katastrophe der „Friedrich Albert“ führte 1905 zum Bau von Schutzhütten, die Nahrungsmittel und Brennmaterial sowie Ausrüstung zur medizinischen Notversorgung enthielten. Für viele Schiffbrüchige gab es aber keine Rettung. Sie wurden auf den Friedhöfen der küstennahen Gemeinden von den Isländern würdig bestattet.
Mit einem Gedenkstein möchte der Arbeitskreis „Geschichte der deutschen Hochseefischerei“ am Deutschen Schiffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven an die ums Leben gekommenen Seeleute erinnern und den Isländern für ihren selbstlosen Einsatz danken.
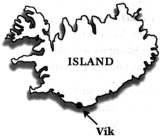 Die Kosten für diesen Gedenkstein werden ausschließlich durch
Spenden aufgebracht. Das Projekt, das zur Völkerverständigung
zwischen Isländern und Deutschen beitragen soll, wird von der Robert
Bosch Stiftung in Stuttgart gefördert, ist aber auch auf Spenden aus
der Bevölkerung angewiesen. Die finanzielle Abwicklung erfolgt in
Zusammenarbeit mit der Deutsch-Isländischen Gesellschaft Bremen/Bremerhaven
e.V., die ein Spendenkonto eingerichtet hat:
Die Kosten für diesen Gedenkstein werden ausschließlich durch
Spenden aufgebracht. Das Projekt, das zur Völkerverständigung
zwischen Isländern und Deutschen beitragen soll, wird von der Robert
Bosch Stiftung in Stuttgart gefördert, ist aber auch auf Spenden aus
der Bevölkerung angewiesen. Die finanzielle Abwicklung erfolgt in
Zusammenarbeit mit der Deutsch-Isländischen Gesellschaft Bremen/Bremerhaven
e.V., die ein Spendenkonto eingerichtet hat:
Sonderkonto Nr. 1000 220 655 der Deutsch-Isländischen Gesellschaft,
Bankhaus Neelmeyer AG, BLZ 290 200 00, Stichwort: Vik.
Bei dem Gedenkstein handelt es sich um einen sieben Tonnen schweren norddeutschen Granitfels von 2,20 m Höhe und 1,50 m Breite. Der Stein soll von Basaltsäulen aus Island offen umrahmt werden und auf Bronzetafeln in deutscher und isländischer Sprache die Inschrift tragen:
„Zum Gedenken an die Seeleute, die in der deutschen Islandfischerei
ihr Leben verloren.
In Dankbarkeit und Hochachtung den Isländern, die viele Schiffbrüchige
retteten.“
Eine weitere Bronzetafel zeigt einen gestrandeten Fischdampfer.
Nähere Informationen erteilt die Projektgruppe „Gedenkstein in
Vík auf Island“ im Arbeitskreis „Geschichte der deutschen Hochseefischerei“
am Deutschen Schiffahrtsmuseum, Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven,
E-Mail heidbrink@dsm.de. Im Internet
wird unter der Adresse http://vik.dsm.de
über das Projekt informiert.
Hinweis: Die Veröffentlichung des Info-Service ist
kostenfrei. Wir bitten jedoch bei Druckmedien um Übersendung eines
Belegexemplars.
Informationen zum Pressedienst
des DSM
