
 |
|
Der Gezeitenstrom Die auffälligste Erscheinung der Gezeiten ist der wechselnde Wasserstand. Aus nautischer Sicht ist es jedoch meistens der Gezeitenstrom, von dem die stärkere Gefährdung ausgeht und der berücksichtigt werden muß, will man nicht Schiff, Besatzung und Ladung gefährden. Besonders bei unsichtigem Wetter hat quer zur Fahrtrichtung setzender Strom – wie zum Beispiel in der Wesermündung – schon so manches Schiff auf einer Untiefe stranden lassen, von der es nie wieder abgeborgen werden konnte. Aber auch mit- oder gegenanlaufender Strom darf nicht vernachlässigt werden. Vergegenwärtigt man sich etwa, daß ein relativ langsames Segelschiff mit 6 kn (1 Knoten = 1 Seemeile von 1,852 km je Stunde) bei einem mit 3 kn laufenden Strom in einem Zeitraum von 3 Stunden entweder 9 oder aber 27 Seemeilen hinter sich bringt, je nachdem, ob der Strom von vorn kommt und es verlangsamt oder von hinten schiebt, dann wird schnell deutlich, warum die Seeleute schon seit Jahrhunderten darum bemüht sind, enge Passagen oder Flußmündung nur dann zu befahren, wenn es die Tide erlaubt. Heute haben die meisten größeren Staaten von maritimer Bedeutung nationale hydrographische Dienste, die Gezeitentafeln und Stromatlanten erarbeiten, in denen die erforderlichen Informationen mit hinreichender Genauigkeit enthalten sind. In Deutschland ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) die hierfür zuständige Behörde. Doch bevor derartige Daten für die Schiffahrt bereitgestellt werden konnten, war eine Menge Arbeit zu leisten: Es mußten in möglichst engmaschigen Meßnetzen die Naturverhältnisse über einen möglichst langen Zeitraum regelmäßig beobachtet werden. |
|
Der Strom erschwert übrigens nicht nur die Schiffsführung, auch die Fahrwasserunterhaltung und der Hafenbau sind ständig gezwungen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, denn er verlagert gewaltige Mengen von Sediment. Ein eindrucksvolles Beispiel läßt sich ganz aus der Nähe des Museums, von der Bremerhavener Doppelschleuse vor dem Fischereihafen, anführen: Hier transportiert jeder Kubikmeter Weserwasser rund ein Pfund Sediment in den Hafen, das sich in ruhigen Arealen absetzt und rasch zur Verschlickung führt, wenn nichts dagegen unternommen wird. Auch die Fahrwasser im Gezeitenrevier werden durch Sedimente beeinträchtigt. Schon im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit versuchten deshalb Hafenstädte und Küstenanrainer, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die für eine sichere Schiffahrt erforderliche Wassertiefe zu erhalten; vor Einführung von maschinellen Antrieben ein nahezu aussichtsloses Unterfangen, wenn man sich nicht wiederum die Kräfte der Natur zunutze machte, wie es das Modell eines Kratzbaggers aus der Zeit um 1700 zeigt. |
|
|
|
Moderne Bagger zur Erhaltung oder Vertiefung des Fahrwassers arbeiten anders. Sie verwenden im Regelfall Saugrohre, um das Sediment im Schiffsrumpf in die offene See zu transportieren (Modell Wado). Bei einem Spaziergang auf dem Weserdeich hinter dem Museum wird man mit einiger Sicherheit einen dieser ganzjährig arbeitenden Bagger zu Gesicht bekommen. Lediglich bei harten Böden werden Eimerketten verwendet, ihre Funktionsweise ist gut am Modell des Baggers Thor in der Ausstellung zu erkennen. Derartige Arbeiten sind in Deutschland Aufgabe der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) bzw. ihrer Dienststellen, den regionalen Wasser- und Schifffahrtsdirektionen und den lokalen Wasser- und Schifffahrtsämtern, die auch für die Fahrwasserbezeichnungen (Seezeichen) zuständig sind, wie zum Beispiel auch den Wasserstandsanzeiger aus dem Jahr 1903 auf dem Deich hinter dem Museum, der bis immerhin 1973 rund um die Uhr den aktuellen Wasserstand und die Stromrichtung für die Schiffahrt auf der Weser anzeigte. Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes unternimmt mit ihren Dienststellen auch die aufwendigen Messungen der Gezeiten im Küsten- und Seeschiffahrtstraßenbereich. Ferner verfügt sie über ein angeschlossenes Forschungsinstitut, das sie in allen praktischen und wissenschaftlichen Fragen berät, die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), deren Außenstelle Küste (BAW-AK) in besonderer Weise mit den Gezeiten und ihren Folgen beschäftigt ist. Doch dazu später mehr. Strömungsmessungen scheinen auf den ersten Blick eine recht einfache Sache: Stromgeschwindigkeit und –richtung sind einschließlich der jeweiligen Zeit der Messung festzustellen. In der Praxis stellt sich jedoch eine Vielzahl von Meßproblemen: Einsatz und Bedienung der Geräte sollen möglichst einfach sein und nur wenig Personal erfordern. Die Geräte dürfen während der Messung nicht durch treibende Wasserpflanzen verkrauten oder durch Sediment in den Lagern schwergängig werden. Die elektrischen Kontakte der Meßwertübertragung müssen vor Korrosion geschützt werden bzw. bei gekapselten Meßgeräten muß die Wasserdichtigkeit auch nach längerem Einsatz noch gewährleistet sein. Wenn die Geräte von einem Schiff aus eingesetzt werden, darf die normalerweise mit einem Kompaß gemessene Stromrichtung nicht durch die Eisenmassen des Schiffes verfälscht werden. Dazu kommt der bei allen Unternehmungen stets bedeutsame ökonomische Faktor: Meß- und Auswertungsarbeiten sollen nach Möglichkeit wenig kosten, will man doch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln noch andere Aufgaben bewältigen.. |
|
|
|
Die historischen und modernen Strommeßgeräte in der Ausstellung spiegeln all diese Probleme und ihre recht unterschiedlichen Lösungsansätze wider. Gleich am Anfang der vor der Fensterfront aufgehängten Instrumente fällt eine geradezu skurrile Konstruktion auf, deren Schöpfer, Heinrich Rauschelbach, eine der Schlüsselfiguren der deutschen Gezeitenforschung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist. |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Rauschelbach wollte den Einfluß des eisernen Schiffsrumpfes des das Gerät tragenden Beobachtungsschiffes auf die generell magnetisch vorgenommenen Stromrichtungsmessungen verhindern. Er hängte deshalb sein Instrument „bifilar“, das heißt, an zwei Kabeln, unter dem Schiff auf, so daß seine Lage im Wasser in bezug auf das Schiff fixiert war. Nun griff er lediglich den Winkel zwischen dem eigentlichen Meßflügel und dem Rohrrahmen elektrisch über die Kabel ab und ließ während der Messung auch die Anzeige des Schiffskompasses in Zeittabellen notieren. Der Steuerkompaß an Bord mußte ja ohnehin ständig kontrolliert und seine Fehler in der sog. Steuertabelle genauestens vermerkt werden. Nach der Messung wurden dann die Winkelangaben des Strommeßgerätes und die Gradangaben des Kompasses zusammengerechnet. Die so entstandenen Meßwerte lagen nach Rauschelbachs Angaben – was die Stromrichtungen anbelangt – bei einer Ablesegenauigkeit von 3° und damit deutlich über dem, was man bis dahin gewohnt war. Der Nachteil des Instrumentes ist jedoch mehr als augenfällig: Das Verfahren war mühselig, das Gerät groß und schwer. Es konnte nur mit mehreren Hilfskräften transportiert und eingesetzt werden. Die in die Ausstellung mit aufgenommenen Transportkisten verdeutlichen das, obwohl die beiden Auslegekräne und die Winden noch nicht einmal dabei sind. Überdies war die Präsenz eines ganzen Schiffes mit seiner Besatzung und dem mit der Messung beschäftigten Fachpersonal erforderlich. Es ist leicht vorstellbar, mit welchen Kosten die Vermessung eines weitläufigen Gezeitenreviers mit seinen zahlreichen Meßpunkten verbunden war. Jüngere Geräteentwicklungen zeigen in dieser Hinsicht viele Verbesserungen. Insbesondere der in der Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitete Schaufelradstrommesser 202 der Firma Hydrowerkstätten, Kiel, geht vollkommen neue Wege. Militärische Entwicklungen des Zweiten Weltkrieges inspirierten seine Funktion und Formgebung: Die spezielle, vorab auf eine bestimmte Tiefe eingestellte Bodenverankerung stammt von den Seeminen, die Formgebung des Instrumentes selbst von den strömungsgünstig gestalteten Torpedos. Dieses Gerät, das in einem frühen aluminiumgrauen Prototyp und im auffälligen Signalgelb in der Mitte der Gerätereihe hängt, arbeitete bereits weitgehend autark. Nach dem Aussetzen konnte es bis zu 28 Tage und bis in 50 m Tiefe Meßreihen aufzeichnen. Das drehbare, gewichtsstabilisierte Registrierwerk innerhalb des wasserdichten, in den Grundkörper eingesetzten Schaufelrades arbeitete mit Hilfe einer Kamera: Alle 5 Minuten belichtete eine batteriegespeiste Lampe die Anzeigen von Umdrehungszählwerk und Kompaß auf einen 16mm-Film, was als opto-mechanisches Verfahren bezeichnet wird. Die Vorteile des Schaufelradstrommessers liegen auf der Hand: Fehlweisungen des Kompasses wurden durch den autarken Betrieb des vollständig eisenfreien Gerätes vermieden. Das Beobachtungsschiff, das beim Rauschelbach-Strommesser noch für den gesamten Meßvorgang erforderlich war, konnte nun in derselben Zeit eine Vielzahl von Messungen vornehmen. Außerdem waren nun auch wetterunabhängige Messungen über einen kompletten Zyklus von Spring-, Mitt- und Nippzeit möglich. Ein Meßgerätetypus erstaunlicher Konstanz in Form und Funktion ist der weltweit verbreitete sogenannte Ott-Flügel. Vergleicht man das Modell der in Kempten am Bodensee beheimateten Firma aus der Zeit um 1900 (s. Tischvitrine) mit dem neuesten, immerhin ein Jahrhundert später hergestellten Modell Delphin vor der Fensterfront, dann ist trotz aller Detailentwicklungen die Verwandtschaft unverkennbar. Schon die ersten dieser auf den Hamburger Wasserbaudirektor Reinhard Woltman zurückgehenden und seit 1881 gebauten Instrumente übertrugen die Umdrehungen ihrer Schaufel elektrisch an einen Impulszähler über Wasser. Daran hat sich auch heute nichts geändert, nur daß inzwischen neben der Stromgeschwindigkeit auch der Druck (zur Feststellung der Tauchtiefe), die Temperatur des Wassers und die mit einem eingebauten elektronischen Kompaß nach dem Fluxgate-Prinzip gemessene Stromrichtung übermittelt wird. Außerdem meldet ein unter dem Gerät montiertes Stabilisierungsgewicht, ob der Flügel Grundkontakt hat. All diese Daten werden mit Hilfe einer komplexen Spezial-Software direkt ausgewertet. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Alle elektro-mechanischen Strommeßgeräte haben jedoch einen Nachteil gemeinsam: Sie messen die Stromgeschwindigkeit lediglich punktuell. Um Aussagen über die Strömungsdynamik eines ganzen Flußlaufes unter Gezeiteneinfluß, eines sogenannten Ästuars, treffen zu können, braucht man viele Geräte, die in unterschiedlichen Tiefen und Positionen ausgebracht sind. Schließlich treten am Flußufer und in den tiefen Rinnen, über den Sänden und in den Prielen sehr unterschiedliche Strömungen auf. Man muß also viele Einzelmessungen nach komplexen mathematischen Regeln zu einem Ganzen zusammenfügen und darauf hoffen, die repräsentativen Meßpunkte „getroffen“ zu haben. Einen anderen Weg geht deshalb das derzeit modernste Strommeßgerät, der Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) des amerikanischen Herstellers RD Instruments, San Diego (USA). Hier wird der sogenannte Doppler-Effekt ausgenutzt, um die Geschwindigkeiten ganzer Strömungsprofile zu bestimmen. Jeder kennt das Phänomen des Reifenlaufgeräuschs von schnell fahrenden Autos, das höher klingt, wenn sie auf den Beobachter zu fahren, und tiefer, wenn sie passieren und davonfahren. Dieser Stauchungs- und Dehnungseffekt der Schallwellen durch die Bewegung wird in der Physik als Doppler-Effekt bezeichnet. Ihn nutzt auch das ADCP-Gerät, indem es Signale im 150 kHz- oder 600kHz-Bereich in das strömende Wasser aussendet und aus den Echos die Geschwindigkeit und die Stromrichtung berechnet. Und ebenso, wie wir in der Lage sind, aus den Laufzeitdifferenzen der unsere Ohren erreichenden Schallsignale verschiedene Autos zu unterscheiden, kann das Gerät die ihm näheren Wasserschichten von den weiter entfernten differenzieren und mit Computerhilfe als Profil abbilden. Mit den Ergebnissen solcher Messungen ist es wiederum unter Nutzung von Computern möglich, die Strömungsdynamik eines Ästuars numerisch nachzubilden und wasserbauliche Veränderungen wie Fahrwasservertiefungen in einem sogenannten hydro-numerischen Modell auf ihre Konsequenzen für eben diese |
|
|
|
Strömungsdynamik durchzurechnen. Die geradezu gigantische Datenmenge derartiger Modelle erfordert allerdings Supercomputer, die dem neuesten Stand der digitalen Technologie entsprechen müssen. Sehen Sie sich dazu die Präsentation der Bundesanstalt für Wasserbau, Außenstelle Küste, in der DSM-Ausstellung an. Hier werden in Animation ADCP-Messungen wiedergegeben, die im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zur Errichtung eines Tiefwasserhafens an der Jade durchgeführt wurden. Interessanterweise gab es auch schon vor der Entwicklung von Computern großer Leistungsfähigkeit die Möglichkeit, wasserbauliche Maßnahmen im Vorfeld durch Modelle auf ihre Konsequenzen hin zu prüfen: Die betreffenden Ästuare wurden tatsächlich im Modell nachgebaut. Die Bundesanstalt für Wasserbau, Außenstelle Küste (ehemals Außenstelle Seebau), verfügt noch über sog. hydraulische Modelle der wichtigsten westdeutschen Flüsse mit beeindruckenden Abmessungen: Das Elbmodell zum Beispiel, das das Flußbett von Scharhörn bis Hamburg im Längen- und Breitenmaßstab 1:500 abbildet und auch die kleinsten wasserbaulichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte – selbst Veränderungen in den einzelnen Becken des Hamburger Hafens - wiedergibt, ist ca. 400 m lang und bedeckt rund 6000 m² |
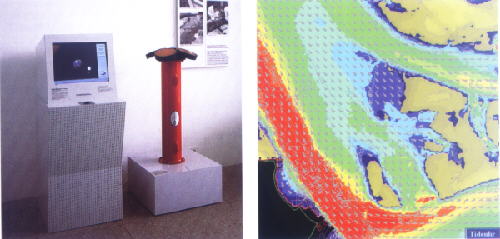 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||